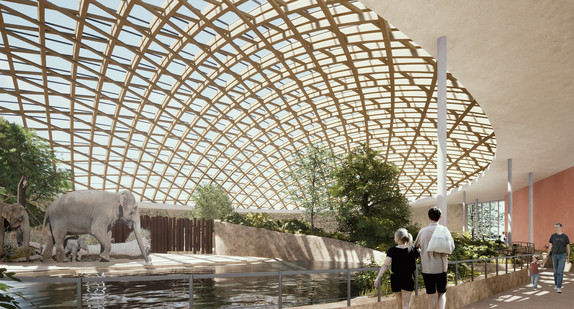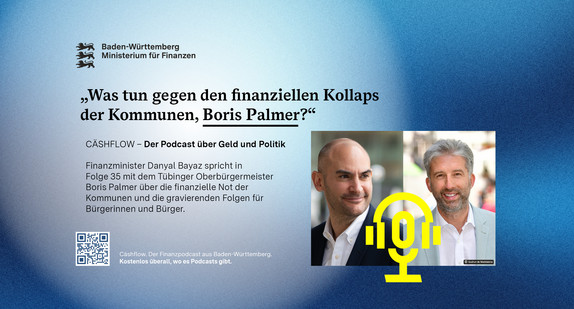Der Staatssekretär im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium, Richard Drautz, wird am kommenden Montag (19.10.) in Stuttgart die Tagung „Wege zum Bioenergiedorf: Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung“ eröffnen. Dort wird auch die finanzielle Unterstützung durch den Bund und das Land dargestellt. Drautz: „Ich bin stolz, auf dieser Tagung das neue Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums für Bioenergiedörfer der Öffentlichkeit vorstellen zu können.“
Bereits bisher wurden Bioenergiedörfer durch das Land gefördert. Bislang war dabei das „besonders innovative Konzept“ Fördervoraussetzung. Zukünftig können Bioenergiedörfer grundsätzlich gefördert werden: förderfähig sind Vorhaben, bei denen die Wärmeversorgung von Gemeinden, Städten sowie Orts- oder Stadtteilen überwiegend durch den Einsatz von Bioenergie, auch in Kombination mit anderen erneuerbaren Energien gedeckt wird. Es wird also jetzt bewusst ein sehr breiter Ansatz gewählt, der sowohl hinsichtlich kommunaler Grenzen als auch hinsichtlich der einzusetzenden erneuerbaren Energien sehr offen gestaltet ist.
Beim Verfahren wird das bewährte Modell des Bioenergiewettbewerbs übernommen. Die vorhandenen Mittel werden im Rahmen eines Wettbewerbs ausgeschrieben werden, um den sich Projektträger mit ihren Vorhaben bewerben können. Alle drei Monate werden die bis zum jeweiligen Stichtag eingegangenen Anträge bewertet, unterstützt durch einen Beirat mit Vertretern der Verbände, der Verwaltung und der Wissenschaft. Die Antragsfrist für den ersten Förderdurchgang endet am 31. Oktober.
Info
Das kleine Dorf Jühnde in Niedersachsen hatte es vorgemacht: ein Dorf kann sich weitgehend autark aus eigenen Quellen mit Energie versorgen. Und weil der größte Teil der Energie aus Biomasse erzeugt wird, wurde dafür der Begriff Bioenergiedorf geprägt. Längst brauchen die Gemeinden in Baden-Württemberg nicht mehr nach Niedersachsen fahren, um sich ein Bioenergiedorf aus der Nähe anzuschauen. Die Idee ist auch hier im Land auf fruchtbaren Boden gefallen. Der erste Ort in Baden-Württemberg, der sich über die Nutzung von Bioenergie weitgehend autark mit Energie versorgt, ist Mauenheim (ein Ortsteil von Immendingen, Kreis Tuttlingen, mit ca. 400 Einwohnern). Das Bioenergiedorf Mauenheim entfaltete eine große Vorbildwirkung. In der Folge wurden in einer Reihe von Kommunen entsprechende Überlegungen angestellt.
Die Internetseite des Bundeslandwirtschaftsministeriums „Wege-zum-Bioenergiedorf.de“ zeigt eine Karte mit den geplanten und bereits realisierten Bioenergiedörfern in Deutschland. Mit sieben energieautarken Kommunen liegt demnach ein Drittel aller deutschen Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg. Und das, obwohl eine Reihe von Vorhaben, die sich derzeit in Bau befinden, dort noch gar nicht dargestellt sind. Tatsächlich existieren bereits dreizehn Bioenergiedörfer, fünf in Betrieb, acht im Bau. Und in vielen Gemeinden werden Pläne geschmiedet, Vor- und Nachteile abgewogen und Initiativen gegründet. Für diese soll die Tagung im Haus der Wirtschaft Hilfestellung geben, wie der häufig beschwerliche Weg zu einem Bioenergiedorf erfolgreich beschritten werden kann.
Auf der vom Wirtschaftsministerium zusammen mit dem baden-württembergischen Gemeindetag, dem Fachverband Biogas und dem Holzenergiefachverband organisierten Tagung werden den Teilnehmern die wesentlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt. Ist Biomassenutzung nachhaltig und zukunftsfähig? Ist die Wärmelieferung aus einer Biogasanlage zuverlässig? Wie muss man sich eine Nahwärmeversorgung im Dorf vorstellen? Wie viele Haushalte müssen mitmachen, damit sich das Ganze lohnt? Welche rechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? Wer ist die treibende Kraft? Welche Organisationsstrukturen haben sich bewährt?
Die Probleme bei der Umsetzung werden von Akteuren aus bestehenden oder sich im Bau befindlichen Bioenergiedörfern aus der Praxis beleuchtet. Noch sind die Wege zum Bioenergiedorf nicht ausgetreten, noch können Neueinsteiger vieles aus Versuchen, Fehlern und Erfolgen der bereits Aktiven lernen.
Meist produziert eine Biogasanlage den erforderlichen Strom, der ins Netz eingespeist wird. Die dabei anfallende Wärmeenergie sorgt zusammen mit einer Hackschnitzelfeuerung ganzjährig für warmes Wasser und warme Häuser. Zur Übertragung der zentral erzeugten Wärme dient ein Nahwärmenetz, Pufferspeicher dienen zusätzlich zur Abdeckung von Wärmespitzen. Ziel einer guten Konzeption muss dabei sein, möglichst viel der ganzjährig in der Biogasanlage anfallenden Wärme tatsächlich zu nutzen.
Ein Bioenergiedorf macht die Bürger unabhängig von Energieimporten, da die Energie vor der eigenen Haustür erzeugt wird. Es können günstige Wärmepreise über lange Zeiträume gesichert werden. Und durch Bürgerbeteiligung kann sogar ein eigenes Mitspracherecht erreicht werden. Für die energieautarken Kommunen ergibt sich eine stark erhöhte lokale und regionale Wertschöpfung, da die Ausgaben für Energie vor Ort bleiben und nicht in ferne Regionen abfließen. Es verdient der Landwirt, der Forstwirt, die Handwerker und die Bauindustrie im Dorf und in der Region. Und auch das Land hat Vorteile, wenn die Energieeffizienz verbessert wird, wenn die Bioenergie nachhaltig genutzt wird.
Infos zur Förderrichtlinie Bioenergiedörfer
- Gefördert werden Kommunen, Unternehmen, Landwirte und Bürgerunternehmen
- Zuschuss bis zu 20 Prozent der förderfähigen Investitionskosten, maximal 100.000 Euro je Einzelmaßnahme
- Kumulierung mit Bundesprogrammen ist möglich
- Gefördert wird eine zentrale Wärmeversorgung in Kommunen und Ortsteilen durch den Einsatz erneuerbarer Energien, bevorzugt aus Kraft-Wärme-Kopplung
- Auswahlkriterien sind der Ersatz fossiler Energieträger, die Energie- und Ressourceneffizienz, die Kosteneffizienz, die Qualität der Planung und die Vorbildfunktion
- Antragsstellung erfolgt auf vorgeschriebenem Formblatt, das unter info@bioenergiedorf-bw.de angefordert werden kann
Quelle:
Wirtschaftsministerium