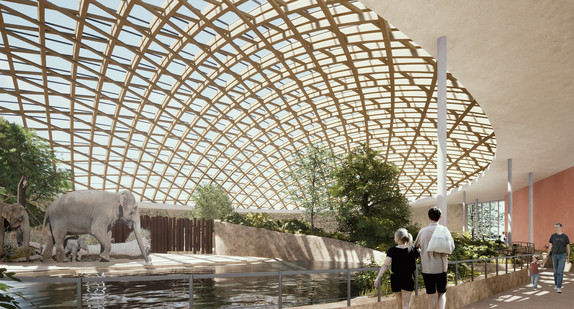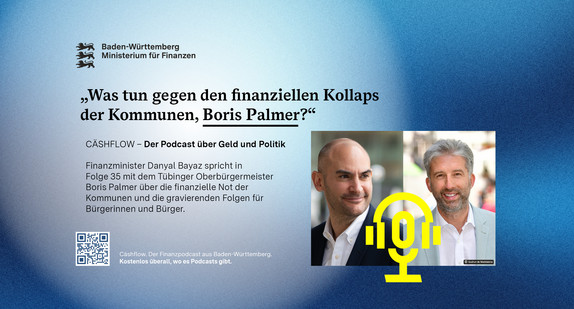„Unbestritten ist, dass stabile Einlagensicherungssysteme für das Vertrauen der Bankkunden fundamental sind. Hier haben sich aber gerade in der Banken- und Finanzmarktkrise die freiwilligen Sicherungseinrichtungen der deutschen Kreditwirtschaft bewährt, denn sie reichen über die gesetzlichen Vorgaben weit hinaus. Nicht ohne Grund waren in der Banken- und Finanzmarktkrise gerade die Sparkassen und Genossenschaftsbanken ‚sichere Häfen’. Diese stabilisierende Funktion muss ohne Abstriche aufrecht erhalten werden. Die geplante EU-Richtlinie zur Einlagensicherung rüttelt an diesen Grundpfeilern der Stabilität und muss daher in wesentlichen Punkten verbessert werden." Dies sagte Finanzminister Willi Stächele am Freitag (24. September 2010) anlässlich der Beschlussfassung des Bundesrates.
So würden die Institutssicherungen der Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen durch die EU-Richtlinie künftig nur noch anerkannt, wenn sie sich als so genanntes Einlagensicherungssystem anerkennen ließen. Damit werde die bisherige Gleichwertigkeit von institutssichernden Systemen und Einlagensicherungssystemen ohne Not aufgegeben. Dabei werde nicht gesehen, dass die institutsbezogenen Sicherungssysteme im Vergleich zur Einlagensicherung einen wichtigen präventiven Ansatz wählten. „Während die institutssichernden Systeme bereits die Insolvenz eines Kreditinstituts verhindern, greift die Einlagensicherung erst dann ein, wenn die Bank schon zahlungsunfähig ist. Dieser fundamental unterschiedliche Ansatz führt zwangsläufig zu einem abweichenden Regelungsbedarf, den die Richtlinie nicht berücksichtigt", so Stächele.
Die im Richtlinienvorschlag enthaltene Alternative, dass Banken sowohl einer Institutssicherung als auch einer gesetzlichen Einlagensicherung angehören können, biete dagegen keine ernsthafte Alternative. Denn infolge der geforderten Mindestbeiträge für das EU-Einlagensicherungssystem führe dies im Ergebnis zu einer Doppelbelastung der Institute. „Die bisherigen Befreiungen für die effizienten und kostengünstigen institutsbezogenen Sicherungssysteme müssen deshalb bestehen bleiben", betonte der Finanzminister.
Zudem plane die EU künftig die Deckungssumme auf 100.000 Euro je Kunde festzuschreiben. Höhere Beträge seien nach der bisherigen Fassung mit der Begründung unzulässig, dass dadurch angeblich gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa geschaffen würden. „Bei solchen Änderungen schüttet man das Kind mit dem Bade aus. Denn damit wird nur der kleinste gemeinsame Nenner für alle verbindlich festgeschrieben. Die Sicherungssysteme der Sparkassen und Genossenschaftsbanken garantieren ihren Kunden demgegenüber, dass Einlagen in unbegrenzter Höhe geschützt sind. Bisher können Anleger daher frei wählen, ob sie ein über den EU-Vorgaben liegendes Schutzniveau wünschen. Diese Option muss erhalten bleiben", unterstrich Stächele.
Unter keinen Umständen sei aber die Finanzierung der jeweiligen Einlagensicherungssysteme hinzunehmen. Nach dem vorliegenden Konzept sei auch eine grenzüberschreitende gegenseitige Kreditvergabe der verschiedenen Systeme vorgesehen. „Diese Verpflichtung zur Gewährung von Krediten führt zu einer Mithaftung für Einlagensicherungssysteme anderer Mitgliedsstaaten. Dies ist abzulehnen. Diese Mithaftung durch ‚Zwangskredite’ würde nämlich eine Vorstufe für einen EU-weiten Einlagensicherungsfonds darstellen. Diesen hat der Bundesrat aber bereits abgelehnt," sagte Finanzminister Willi Stächele abschließend.
Quelle:
Finanzministerium Baden-Württemberg